Wie können sich Landwirtschaft und Gesellschaft annähern? - Interview mit Philosoph Dr. Christian Dürnberger

Landwirtschaft und Gesellschaft stehen sich manchmal unversöhnlich gegenüber: Da werden Landwirte kritisiert, weil sie im Sommer mit großen Erntemaschinen auf den Feldern und Landstraßen unterwegs sind. Zu viel Krach, zu viel Staub, zu viele Behinderungen im Straßenverkehr, so die Vorwürfe. Oder Tierhalter werden kritisiert, die Schweine oder Rinder für die Lebensmittelproduktion halten. Schließlich sei es moralisch nicht vertretbar, überhaupt Tiere für die menschliche Ernährung zu nutzen. Auch der Landwirt, der seine Pflanzen vor Krankheiten schützen will und hierfür chemische Mittel einsetzt, sieht sich Anfeindungen ausgesetzt. Schließlich seien Pestizide generell schädlich für Menschen und andere Lebewesen. So ließen sich noch weitere Beispiele nennen bis hin zu Fällen von Mobbing von Bauernkindern.
Die gesellschaftlichen Diskussionen zur Landwirtschaft beschäftigen die Branche seit einigen Jahren. Die Initiative Heimische Landwirtschaft wurde gegründet, um Brücken zu bauen und Verbraucherinnen und Verbrauchern die Welt der Landwirtschaft zu zeigen. Landwirte und Konsumenten sollen Verständnis füreinander entwickeln und Vertrauen soll entstehen.
Doch auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Landwirtschaft und Gesellschaft. Einer der Experten auf diesem Gebiet ist Dr. Christian Dürnberger. Sein neuestes Buch trägt den Titel „Ethik für die Landwirtschaft“ und richtet sich an Landwirtinnen und Landwirte selbst. Dürnberger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Messerli Forschungsinstitut, Abteilung Ethik an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Der studierte Philosoph und Kommunikationswissenschaftler forscht und lehrt unter anderem zur Ethik in der Landwirtschaft sowie der Veterinärmedizin. Mit ihm haben wir von der Initiative Heimische Landwirtschaft über sein Buch, die Erwartungshaltung von Verbrauchern auf der einen und Landwirten auf der anderen Seite gesprochen und wollten auch wissen, wie der Brückenschlag gelingen kann.
Sie sind promovierter Philosoph und haben mit „Ethik für die Landwirtschaft“ ein Buch geschrieben, das sich an Landwirte und Landwirtinnen richtet. Das ist doch eher ungewöhnlich. Was reizt Sie an ethischen Fragen der Landwirtschaft besonders?
"Wer sich heute mit Ethik beschäftigt, der landet irgendwann bei der Landwirtschaft, denn in der Landwirtschaft laufen viele entscheidende Fragen zusammen: Nahrung, Umweltschutz, Klimakrise, Tierwohl, etc. Mir war es wichtig, hier nicht zu (ver)urteilen, also nicht zu sagen: „Das ist richtig! Und das ist vollkommen falsch!“ Vielmehr will ich, dass Landwirtinnen und Landwirte die Debatten besser verstehen und an ihr aktiv teilnehmen. Dazu aber müssen sie über den Tellerrand hinausblicken."
Viele Landwirte und Landwirtinnen sehen sich ständiger Kritik durch die Gesellschaft ausgesetzt, empfinden die Ansprüche von Verbraucherinnen und Verbrauchern als weltfremd und fühlen sich gegängelt. Sind die kritischen Stimmen in den letzten Jahren tatsächlich lauter geworden oder reagieren die Landwirte zu empfindlich?
"Die kritischen Stimmen sind in der Tat lauter geworden. Ohne Zweifel. Die entscheidende Frage ist: Ist die Kritik berechtigt? Und wenn ja, also wenn es in der Landwirtschaft tatsächlich dringend notwendig ist, Dinge zu verändern und zu verbessern, dann wie? Es sind demnach beide Seiten aufgerufen, konstruktiv zu sein: Kritiker sollten sich nicht einfach nur empören, sondern praxisnahe Vorschläge machen und darum wissen, dass es „die Gesellschaft“ ist, die im Grunde bestimmt, wie Landwirtschaft abläuft. Landwirtinnen und Landwirte auf der anderen Seite sollten offen sein, für die veränderten gesellschaftlichen Erwartungen. Sie produzieren immerhin nicht für sich selbst."
In der Landwirtschaft hat sich eine Art Wagenburgmentalität gebildet. Können Sie diesen Eindruck bestätigen und wie ist es Ihrer Meinung nach dazu gekommen?
"Psychologisch kann ich das voll und ganz verstehen: Man sieht sich einer entfremdeten Gesellschaft gegenüber, die so gut wie gar nichts über die „Realität“ weiß, wie Nahrungsmittel produziert werden, zugleich aber meist nur „Spottpreise“ für das Essen bezahlen will. Ich verstehe also jeden Bauern, jede Bäuerin, der/die darüber verbittert ist, nur: Verbitterung bringt nichts. Man möchte ja Kunden/Kundinnen von den eigenen Produkten überzeugen wie auch der Gesellschaft kommunizieren, dass man einen wichtigen Beruf verantwortungsvoll ausübt – und genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben: Man muss sich selbst kritisch hinterfragen, aber auch in der Debatte mitmischen."
Bleiben wir bei diesem letzten Satz. In ihrem aktuellen Buch „Ethik für die Landwirtschaft“ beschreiben Sie, dass es zum Berufsbild von Landwirten heute dazu gehört, sich mit ethischen Fragen und insbesondere auch den gesellschaftlichen Erwartungen zu beschäftigen. Warum ist das so relevant?
"Die Landwirtschaft sieht sich gegenwärtig vor besondere Herausforderungen gestellt: Bestimmte Praktiken sind umstritten, das gesellschaftliche Wissen ist gering – die Erwartungen sind es jedoch nicht. In diesem Spannungsfeld sollen Landwirtinnen und Landwirte nicht nur ihrer besonderen Verantwortung gerecht werden, mehr als das: Sie sollen in den Debatten Rede und Antwort stehen. Zum modernen landwirtschaftlichen Berufsbild gehört demnach ethische Reflexionsfähigkeit. Ethik für die Landwirtschaft also. Was aber ist Ethik? Wie lassen sich die neuen gesellschaftlichen Erwartungen beschreiben? Und was bedeutet Verantwortung mit Blick auf Nahrung, Umwelt, Klima und Tiere? Genau auf diese Fragen – und andere – liefert das Buch Antworten."
Was erwarten Verbraucherinnen und Verbraucher von der heimischen Landwirtschaft?
"Im Grunde geht es vor allem um drei Erwartungen: Erstens ausreichend Nahrungsmittel, die sicher und leistbar sind. Zweitens Werte wie Klima-, Umwelt- und Tierschutz und auch drittens bestimmte Bilderwelten rund um eine „ursprüngliche“ Landwirtschaft."
Die beiden ersten Punkte sind oft diskutiert, was aber meint der letztgenannte?
"Wenn Sie heute einem durchschnittlichen Bürger einen hochtechnisierten landwirtschaftlichen Betrieb zeigen, in dem die Robotik alles erledigt, wird er sagen: „So stelle ich mir Landwirtschaft eigentlich nicht vor.“ Warum? Weil Landwirtschaft oftmals mit einer gewissen Ursprünglichkeit und Beschaulichkeit assoziiert wird. Das nenne ich im Buch das „landwirtschaftliche Idyll“: Der Bauer als eine Lebensform in und mit der Natur, abseits der Hektik des modernen Lebens. Diese Romantisierung der Landwirtschaft hat Vorteile, immerhin funktioniert sie wunderbar im Marketing. Man kann Bilder zeigen, die die Menschen lieben. Aber sie ist auch ein Stolperstein, denn: Schaut gegenwärtige Landwirtschaft wirklich so aus wie im Bilderbuch? Treibt die Idyllisierung im Marketing die Entfremdung noch voran?"
Und was erwarten Landwirtinnen und Landwirte von der Gesellschaft? Wie kann es gelingen, Landwirtschaft und Gesellschaft einander anzunähern?
"Landwirtinnen und Landwirte erwarten sich ein finanzielles Auskommen, allgemeine Wertschätzung, wissenschaftsbasierte Debatten wie Entscheidungen und auch eine Zukunftsperspektive. Für all das – aber auch, um den Erwartungen der kritischen Stimmen gerecht zu werden – braucht es eine breite gesellschaftliche Debatte, welche Landwirtschaft wir als Gesellschaft eigentlich verantworten können und wollen. Die große, bislang weitgehend schweigende Mehrheit der Bevölkerung muss sich bekennen: Welche Landwirtschaft will sie? Erst auf Basis einer gemeinsamen Zielvorstellung kann so etwas wie ein neuer Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft erarbeitet werden. Wird diese Debatte nicht geführt, ist es nicht zuletzt zum Schaden jener Akteure, die mit der Landwirtschaft beruflich zu tun haben. Diese Berufe sind in der Pflicht: Sie haben die Expertise und die unmittelbare Verantwortung für Nahrung, Tiere, Klima und Umwelt; eine mittelbare Verantwortung aber haben auch wir Bürgerinnen und Bürger: Wir sind es, die die Rahmenbedingungen der Landwirtschaft vorgeben. Damit Landwirtinnen und Landwirte sich diesem „großen Ganzen“ der Debatte nicht verschließen… habe ich dieses Buch geschrieben."
Über das Buch:
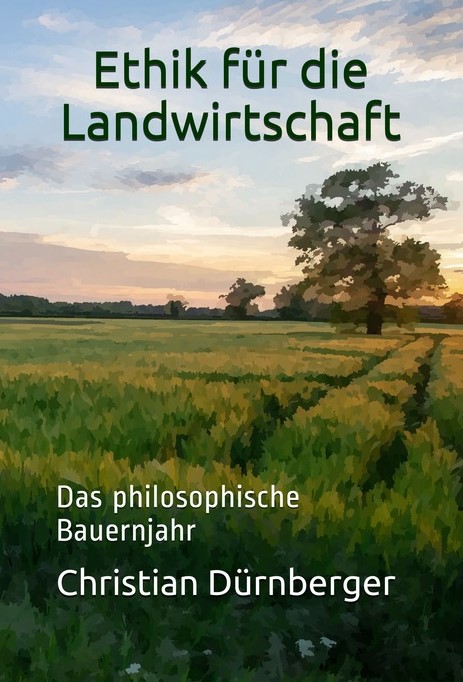 Dr. Christian Dürnberger: Ethik für die Landwirtschaft. Das philosohische Bauernjahr. 2020.
Dr. Christian Dürnberger: Ethik für die Landwirtschaft. Das philosohische Bauernjahr. 2020.
Exklusiv erhältlich über Amazon unter diesem Link: https://amzn.to/2YziFZD
© Foto: Dr. Christian Dürnberger, privat.
Beitrag jetzt teilen

Bereits
1157 Mitgliedsbetriebe
aus ganz Deutschland


